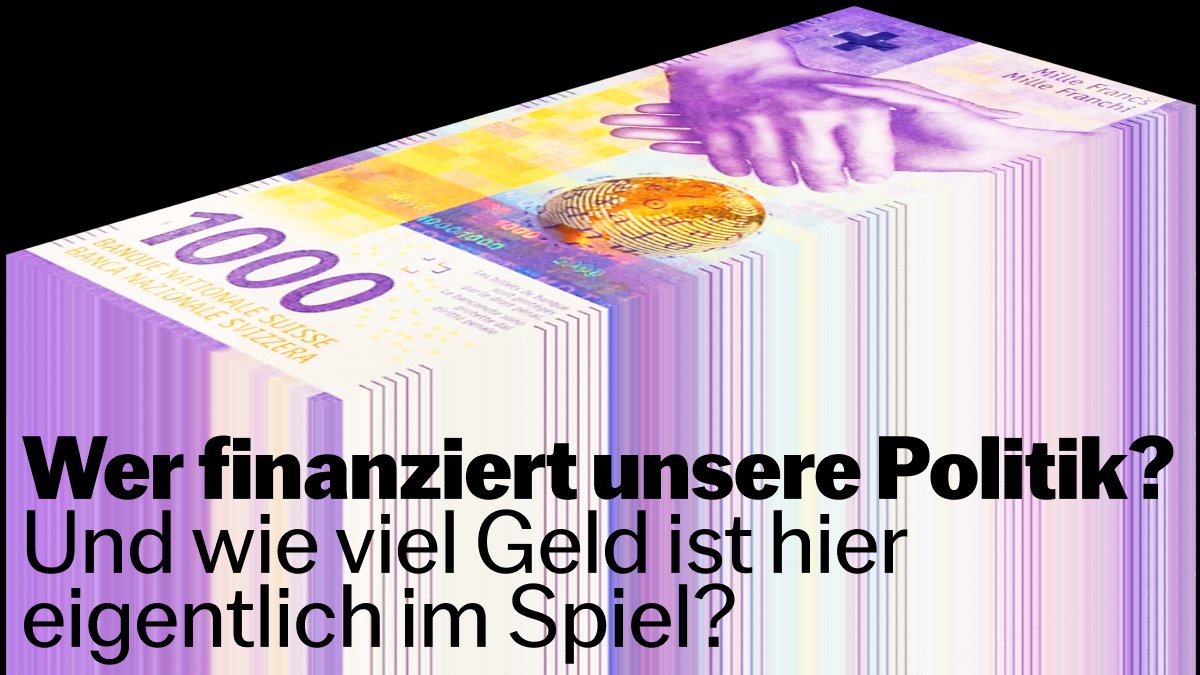Goldener Bremsklotz 2023: Die Nominierten!
Wer soll den Goldenen Bremsklotz 2023 für die grösste Informationsverhinderung des Jahres erhalten? Wie jedes Jahr hat der Vorstand von investigativ.ch aus euren zahlreichen Vorschlägen drei Spitzenkandidaten ausgewählt.
- Der geheime CS-Deal: Finanzministerin Karin Keller-Sutter
- Die untransparenten Preise: Migros
- Die verweigerten Stellungnahmen: Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr
Abstimmen können alle Mitglieder von investigativ.ch. Sie haben ein entsprechendes Mail erhalten.
Der geheime CS-Deal
Obwohl die Öffentlichkeit beim Zusammenbruch der Credit Suisse und der anschliessenden Übernahme durch die UBS mit 209 Milliarden Franken haftete, wird ihr der Zugang zu relevanten Informationen verwehrt. Der Bundesrat – an vorderster Front die federführende Finanzministerin Karin Keller-Sutter – hat gestützt auf eine Notverordnung gehandelt und viele Aspekte des Falls zur Geheimsache erklärt. Informationen, vor allem bezüglich Liquiditätshilfen und Ausfallgarantien, werden geheim gehalten. Medienschaffende blitzten mit ihren Anfragen zum Krisenfall reihenweise ab. Dieses Vorgehen ist staatspolitisch bedenklich. Es ist unverständlich, weil das Öffentlichkeitsgesetz ausreichende Schutzmechanismen auch für diese ausserordentliche Situation geboten hätte. Eine solche Geheimhaltungspolitik gefährdet das Vertrauen in die Regierung, insbesondere in einer Zeit, in der Vertrauen eine Schlüsselrolle spielt. In dieser Krise wäre maximale Transparenz erforderlich gewesen.
Die Antwort der Finanzdirektorin:
Das EFD verzichtet auf eine Stellungnahme und weist darauf hin, dass die von investigativ.ch kritisierten Entscheide vom Gesamtbundesrat gefällt worden sind.
Die untransparenten Preise
Die Rechtsabteilung des grössten Schweizer Einzelhändlers hat versucht, die Veröffentlichung seiner Margen für Bio-Produkte zu verhindern. Nicht nur die Arbeit der Medien, auch die Arbeit des Preisüberwachers Stefan Meierhans hat die Migros dadurch behindert. Indem sie Berichte von Medien über die hohen Margen der Migros diskreditierte, jedoch keine Transparenz walten liess, um das Gegenteil zu beweisen. Und indem sie die Veröffentlichung des Berichts des Preisüberwachers nicht nur verzögerte, sondern auch erreichte, dass der Preisüberwacher zahlreiche Anpassungen vornahm – mit Anträgen weit über allfällige Geschäftsgeheimnisse hinaus.
Die Antwort der Migros:
Wir waren gegenüber dem Preisüberwacher sehr transparent und haben ihm umfangreiches Datenmaterial zur Verfügung gestellt. Auch haben wir keinerlei Druck auf ihn ausgeübt – dazu haben wir auch gar keine Handhabe. Trotz umfangreicher Untersuchung konnte der Preisüberwacher in seinem Bericht nicht belegen, dass die Migros höhere Margen berechnet. Die Gewinnmargen des Detailhandels und damit auch der Migros sind ausgesprochen dünn. 2022 lag jene der Migros-Gruppe gerade mal bei 1.5%. Ein grosser Teil der Teuerung hat die Migros selber getragen. Darüber hinaus hat die Migros kein Interesse, möglichst viel Gewinn zu erzielen: So bezahlen wir keine Boni und müssen keine Investoren zufriedenstellen.
Ausführliche Nomination & Stellungnahme Migros
Die verweigerten Stellungnahmen
Mario Fehr, Vorsteher der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich, lässt in seiner Kommunikation Willkür walten. Er investiert viel Zeit in Gespräche mit Medienleuten und ermutigt sie enthusiastisch, in seinem Sinne zu berichten. Manchmal ruft er sogar von sich aus Redaktionen an, um sich zu vergewissern, dass die laufende Recherche seinen Vorstellungen entspricht. Bei unliebsamer Berichterstattung hingegen verweigert er die Stellungnahme und Auskunft gänzlich. Die dokumentierten Beispiele sind vielfältig: kritische Fragen zum Hooligan-Konkordat, zum abgesagtes Rosengarten-Fest, Recherchen zu Asylunterkünften in Lilienberg und der Zürcher Polizeikaserne. Die Sicherheitsdirektion mit ihrer Medienstelle ist als öffentliches Amt mit Steuergeldern finanziert – reagiert diese bei kritischen Fragen geharnischt, gibt willkürlich Auskunft und will Redaktionen beeinflussen, agiert sie undemokratisch und transparenzfeindlich.
Die Antwort von Mario Fehr: Mario Fehr hat nicht geantwortet.